Sauberes Wasser ist ein immer knapper werdendes Gut. Das hat der letztjährige Dürresommer auch in Deutschland gezeigt. In der EU arbeitet man an Vorgaben für die Wasserwiederverwendung, etwa in der Landwirtschaft. Auch die Industrie erkennt zunehmend, dass sich Recycling lohnt. Gerade die Prozessindustrie ist auf einen effizienten Einsatz angewiesen. „Kläranlagen sind schon lange keine reinen Reinigungsanlagen mehr, sondern wertvolle Energie- und Rohstoffquellen“, erklärt etwa Franz Greulich, Leiter Industrie Geschäftsbereich Wasser bei Veolia.
Mehr Energie produzieren als verbrauchen
Klärwerke verbrauchen viel Strom. Zugleich seien Abwässer heimliche Energieträger, erklärt Stefan Klinger, Vertriebsdirektor Water Utility D-A-CH bei Grundfos. Reduziert man die Temperatur durch Wärmepumpen, kann man mit diesem Energiepotenzial Gebäude heizen oder kühlen. Aus der organischen Fracht lässt sich Biogas herstellen. Die EU fördert unter dem Namen Powerstep die Entwicklung energiepositiver Kläranlagen, die durch eine Kombination mehrerer Technologien mehr Energie produzieren sollen, als sie benötigen. Stefan Klinger geht aufgrund erster Beispiele davon aus, dass energieautarke Kläranlagen möglich seien: „Sie sind nicht komplett von einer externen Energieversorgung entkoppelt, aber erzeugen im Jahresmittel gleich viel oder sogar mehr Energie, als sie benötigen.“
Ein weiterer Ansatzpunkt ist der Energieverbrauch der Kläranlagen selbst. Gelingt es, die Effizienz zu steigern, hat das nicht nur positive Auswirkungen auf die Klimabilanz, sondern auch auf die Kosten. Laut Xylem macht der Energieaufwand mehr als 11 Prozent der Betriebsausgaben bei Wasserversorgung und Abwasserbehandlung aus. 60 Prozent des Energiebedarfs einer Kläranlage soll laut Endress+Hauser auf die Belebung entfallen. Bei Aerzen kalkuliert man bis zu 80 Prozent für die Gebläse, die die Mikroorganismen mit Sauerstoff versorgen sollen. Durch eine vernetzte Auswertung aller Sensordaten und eine optimierte Steuerung der Maschinen je nach dem aktuellen Bedarf könnte man deutliche Einsparungen erzielen.
Die Rückgewinnung von Lösemitteln oder Salzen aus dem Abwasser kann sich finanziell lohnen. Beim Phosphor macht der Gesetzgeber Druck. Bis 2023 müssen Kläranlagenbetreiber einen Plan zur Rückgewinnung vorlegen. Phosphor ist unter anderem für Düngemittel unersetzlich. Die leicht abbaubaren Vorkommen gehen zur Neige. Klärschlämme enthalten reichlich Phosphate und wurden lange auf Feldern ausgebracht. Allerdings gefährden sie durch Krankheitserreger, Giftstoffe und Schwermetalle oft Böden und Gewässer. Aus diesem Grund gelten seit 2017 strengere Grenzwerte. Klärschlamm lässt sich nun kaum noch auf Feldern oder Deponien entsorgen. Also verbrennt man ihn – aufgrund des hohen Wassergehalts bisher meist zusammen mit anderen Stoffen. Für das Recycling ist eine Monoverbrennung sinnvoller, für die die Schlämme allerdings erst aufwendig getrocknet werden müssen.
Stufe 4: ein Zukunftsprojekt
Kläranlagen arbeiten heute üblicherweise mit drei Reinigungsstufen: mechanisch, biologisch und chemisch. Im Abwasser finden sich jedoch immer mehr potenziell umweltrelevante Spurenstoffe: Medikamentenreste, Hormone, Mikroplastik und multiresistente Keime lassen sich mit konventionellen Methoden nicht entfernen. Eine zusätzliche Stufe wird damit erforderlich. In der Schweiz gibt es bereits erste Vorschriften hierfür; in den nächsten Jahrzehnten sollen Klärwerke dann entsprechend ausgerüstet werden. In Deutschland wird erst über eine Spurenstoffstrategie nachgedacht. Denn bisher gibt es nur Konzepte und Pilotanlagen, aber keine umfassenden Lösungen. Eine gesetzliche Regelung wird für Ende 2020 erwartet. Wie sie konkret aussehen wird, ist derzeit noch unklar.
Je nach Belastungstyp gibt es unterschiedliche Ansätze, die von Membrantechnologien (Ultra- und Nanofiltration) und Aktivkohleverfahren hin zu UV-Anlagen reichen. Unter anderem Xylem setzt neben UV-Licht auf Ozon als umweltfreundliches Biozid, um mikrobiologische Risiken zu eliminieren. Ozon reagiert mit den Spurenstoffen. Im günstigsten Fall sollen dabei Stoffe entstehen, die in der biologischen Stufe zu Biomasse abgebaut werden können. Es können allerdings auch neue, unbekannte Transformationsprodukte entstehen. Aktivkohlefiltration entfernt zwar viele Mikroverunreinigungen, wirkt jedoch nicht hinreichend gegen Keime. Die Technologien sind teilweise teuer und es entstehen Reststoffe, die wiederum zu entsorgen sind. Gut wasserlösliche polare Verbindungen (etwa Glyphosat) lassen sich besonders schlecht eliminieren. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ließt 2018 außerdem verlauten: „Uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass eine vierte Reinigungsstufe multiresistente Keime entfernen kann.“ An Lösungen für die 4. Stufe wird deshalb intensiv geforscht.
Besonders schwierig werden Behandlung und Recycling, wenn sich die Stoffströme vermischen, etwa in einem Chemiepark oder einer kommunalen Kläranlage. Bei einer in den Prozess integrierten Klärung lassen sich die verwendeten Methoden besser anpassen, wie Franz Greulich von Veolia erläutert. Die enthaltenen Stoffe sind bekannt, ebenso die Anforderungen für die verschiedenen Einsätze, ob als Kühl-, Wasch- oder Prozesswasser. Mit spezialisierten Modulen, die man hintereinander schaltet, kann man die Aufbereitung auf die aktuelle Produktion einstellen. Unter anderem Envirochemie, Festo und Grundfos haben dafür Konzepte entwickelt.
Chancen dank Digitalisierung
„Grundsätzlich steckt in der Wasser- und Abwasseraufbereitung noch viel Potential für den Einsatz von Digitalisierungsmaßnahmen“, sagt etwa Ralf Höll, Produktmanager Systemkomponenten & Kommunikation bei Vega. Vorläufig habe der Digitalisierungsgrad in der industriellen Wasserwirtschaft aber noch kein vergleichbares Niveau erreicht wie jener in der Produktion, heißt es dagegen im Positionspapier Industriewasser 4.0 der Dechema. Die Branche steht hier also erst noch am Anfang.
Zwar seien einige Chemieparks und kommunale Betreiber unter den Vorreitern, wie Christoph Wolter, Produktmanager Analyse bei Endress+Hauser, betont. „Viele Betreiber scheuen aber den Einstieg in ein Mammutprojekt, das in seiner Komplexität überfordert, und die vermeintlich hohen Investitionen“, gibt Uwe Schmezer, Leiter Produkt- und Anwendungsmanagement bei Gemü, zu bedenken. „Die Wasserwirtschaft ist aus guten Gründen etwas zurückhaltend“, sagt auch Stefan Klinger von Grundfos. Schließlich gehe es um kritische Infrastrukturen.
Das Dechema-Papier definiert nichtsdestotrotz ehrgeizige Ziele: die Digitalisierung der (Ab-)Wasserwirtschaft selbst, die Verzahnung mit der Produktion und schließlich die Vernetzung mit der kommunalen (Ab-)Wasserwirtschaft. Die Vorteile liegen auf der Hand. Wassermanagement erfordert die genaue Kenntnis der Wasser-, Wärme- und Stoffströme. Werden die Informationen aller Sensoren und Geräte zusammengeführt, kann man die Steuerung optimieren und den Energieverbrauch sowie die Dosierung von Chemikalien effizienter gestalten. Probleme – etwa Korrosionsrisiken bei aggressiven Stoffen, Verstopfungen oder Druckabfall aufgrund von Leckagen – lassen sich frühzeitig identifizieren und ausräumen.
Wird die Wasser- und Abwasseraufbereitung digital an die Produktion angebunden, lässt sie sich auch bei kleineren Losgrößen rasch anpassen. Das Recycling wird erleichtert; Ausfälle werden vermieden; die Produktivität steigt. Die Kommunikation mit den örtlichen Anbietern beugt darüber hinaus Problemen mit Wasserversorgung und Entsorgung vor und macht es möglich, Kapazitäten optimal auszunutzen sowie auf Ereignisse wie Starkregen richtig zu reagieren. Das Bundesforschungsministerium fördert mit Dynawater 4.0 ein Verbundprojekt von acht Partnern unter Koordination der Dechema, das die Potenziale der Digitalisierung nun ausloten soll.
„Eine der Voraussetzungen für die Umsetzung von Wasser 4.0 ist die intensive Kooperation auf Herstellerseite“, ist Dr. Hans Eckhard Roos, Leiter Industry Segment Management Process Industries bei Festo, überzeugt. Maschinenhersteller sollten außerdem Software für die Visualisierung und Analyse der Daten bieten, etwa für Condition Monitoring sowie Predictive Maintenance, und Support leisten, um bei der Implementierung in übergeordnete Prozessleitsysteme assistieren zu können, meint Marcus Jungkunst, Produktmanager Gebläse bei Kaeser Kompressoren.
Innovationen eröffnen Exportchancen
Wasser ist ein zentrales Zukunftsthema. In Deutschland ist die Situation bislang noch vergleichsweise komfortabel. Doch bereits 2012 spürten 53 Prozent der Unternehmen weltweit die Folgen von Wasserknappheit, schlechter Wasserqualität, Überschwemmungen oder von Dürreperioden, ermittelte Econsense, das Forum Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft. Gelingt es, wirksame Lösungen zu entwickeln, so stärkt das nicht nur die internationale Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Firmen. Industriewasser 4.0 wird so auch zu einer wichtigen Chance für den Export von Technologien und Dienstleistungen.







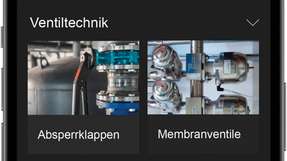



.jpg)







