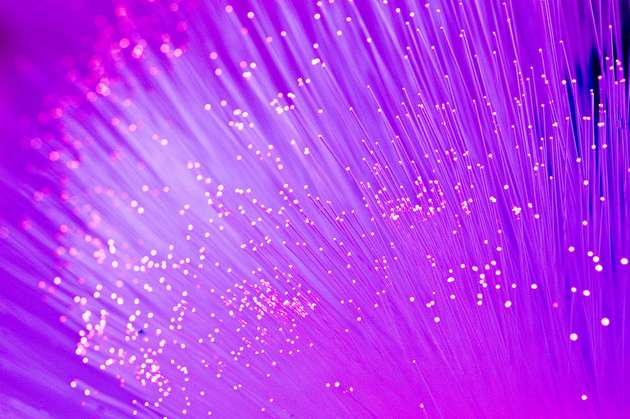Fragt man Kunststoffproduzenten und deren Zulieferer, hat die Branche im Moment eine Vielzahl von Themen, die sie umtreibt. Neben dem allgegenwärtigen Digitalisierungstrend und neuen Verfahren und Werkstoffen, ist vor allem der sparsame Umgang mit Material und Energie ein entscheidendes Zukunftsthema – auch wenn Öl derzeit günstig zu haben ist. Covestro etwa hat ehrgeizige Ziele definiert und will bis 2025 vier Fünftel der Ausgaben für Forschung und Entwicklung für nachhaltige Projekte aufwenden.
Es geht auch ohne Erdöl
Im Juni 2016 nahm das Unternehmen eine erste Anlage zur Nutzung des Klimaschädlings CO2 in Betrieb. Zunächst werden in Dormagen bei der Produktion von Polyolen für Kunststoffschäume 10 bis 20 Prozent des Erdöls durch CO2 ersetzt. Mit Hilfe eines neuartigen Katalysators lässt sich das träge reagierende Gas spalten. Der Energieverbrauch wird durch ein Epoxid als Reaktionspartner reduziert. Weitere CO2-basierte Produkte und Anwendungen sind in der Entwicklung. Das Ziel ist, den Einsatz von Erdöl und Erdöl-Derivaten weiter zu vermindern.
„Die Herstellung von Bio-Polymeren nimmt zu“, sagt etwa Karl-Heinz Bußbach, Global Business Director beim Rohstoffhandling-Spezialisten Azo Poly. Die Fortschritte in der Forschung werden dabei weltweit von Förderprogrammen vorangetrieben. Exotisch klingende Projekte zeigen, welches große Potential hier auf Erschließung wartet: Aus den Wurzelknollen von Chicorée lässt sich ein Rohstoff gewinnen, der sich für die Produktion von Nylon oder PEF-Flaschen nutzen lässt, wie Wissenschaftler der Universität Hohenheim feststellten. Forscher der Universität Bayreuth fanden heraus, wie sich aus Orangenschalen und CO2 hochwertige Kunststoffe herstellen lassen – Beispiele sind etwa antimikrobielle Polymere für Implantate oder hydrophile Polymere, die schneller im Meerwasser abgebaut werden.
Wertvoller Abfall
Konventionelle Kunststoffe sind in der Regel biologisch nicht abbaubar und verrotten nicht. In Deutschland landen aber inzwischen nur noch weniger als 1 Prozent der Abfälle auf der Mülldeponie – rund 99 Prozent werden verwertet. Beindruckend, doch nur rund 40 Prozent werden zu neuen Produkten verarbeitet. Der überwiegende Teil wird der „energetischen Verwertung“ zugeführt, also verfeuert – nicht nur zur Produktion von Strom und Wärme. So verarbeitet beispielsweise die Kollermühle von Amandus Kahl Plastikfolie zu Chips, die zur Blasfeuerung in Zementwerken eingesetzt werden.
In jüngster Zeit ist der Anteil der Verbrennung sogar gestiegen. Das hat mehrere Gründe: Kunststoffe haben einen ähnlichen Brennwert wie Öl oder Gas – Recyclingunternehmen und Energieproduzenten konkurrieren deshalb um den Rohstoff. Je billiger Erdöl angeboten wird, desto schwieriger wird es zudem, kostendeckende Preise für Recyclingkunststoffe zu erzielen.
Am leichtesten zu verarbeiten sind sortenreine Reststoffe – etwa Produktionsabfälle aus der Industrie. Die Mülltrennung dagegen lässt nach wie vor viel zu wünschen übrig. Die Regeln sind kompliziert, die Verbraucher verwirrt. Über ein neues Wertstoffgesetz wird seit langem gestritten. Zu einer Einigung kam es bisher nicht. Nun ist für 2017 nur ein Verpackungsgesetz geplant, mit dem Recyclingquote und -qualität gesteigert werden sollen. Ungeklärt ist weiter, was mit den „stoffgleichen Nichtverpackungen“ geschehen soll. Das duale System kümmert sich nämlich nur um Verpackungsmüll – für Kinderspielzeug und den Gartenstuhl aus Plastik gibt es keine Regelung.
Dennoch gib es inzwischen hochwertige Recyclingkunststoffe, die „Kunststoffen aus Primärware absolut ebenbürtig und auch preislich konkurrenzfähig sind“, sagt Dr. Manica Ulcnik-Krump, Leiterin Forschung und Entwicklung bei Interseroh, einem Recycling-Dienstleister aus der Alba-Gruppe. Um hohe Qualität produzieren zu können, prüfen die Verwerter die Lieferungen der Entsorger immer strenger. Zudem werden die Sortiertechniken immer besser – man arbeitet laufend an ausgefeilteren Lösungen.
Design for Recycling
Problematisch ist es allerdings, „dass wir im Recyclingprozess immer mehr mit mehrschichtigen oder Mehrkomponenten-Kunststoffen zu tun haben, die nur schwer beziehungsweise nicht ohne Verluste zu verarbeiten sind“, erklärt Dr. Ulcnik-Krump. Die Unternehmen des Fachverbands Kunststoffrecycling im Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) wünschen sich deshalb, dass schon bei der Produktentwicklung an die Wiederverwertbarkeit gedacht wird. Das bedeutet, auf nicht notwendige, schwer zu trennende Materialkombinationen, etwa Mehrschichtfolien, auf Füllstoffe und zu starke Pigmentierung zu verzichten.
Geht es um innovative Anwendungen, werden Materialkombinationen allerdings immer wichtiger. „Technische Compounds sind ebenso wie Verbundwerkstoffe die wichtigsten Motoren für Quantensprünge in der Produktentwicklung“, meint Gerhard Baus, Prokurist Gleitlager bei Igus. Neuartige Präzisionspolymere eröffnen ungeahnte Möglichkeiten – etwa in der Energieproduktion, in Medizin und Nanotechnologie. Im Flugzeugbau und im wachsenden Markt der Elektrofahrzeuge wird Metall zunehmend durch Kunststoff ersetzt, um Gewicht und damit Energie zu sparen. „Leichtbau und die werkzeuglose Fertigung sind bestimmende Themen der Zukunft, die unsere Mobilität und auch die Konsumgüterindustrie stark beeinflussen werden,“ so Dr. Matthias Kottenhahn, Leiter der Business Line High Performance Polymers bei Evonik.
Eine neue industrielle Revolution
Das Internet der Dinge stellte man sich lange so vor: Der Kühlschrank merkt, dass die Milch zur Neige geht, bestellt die Lieblingssorte rechtzeitig nach, wählt den aktuell günstigsten Anbieter und gleicht mit dem Kalender ab, wann die Lieferung erfolgen soll. Nett, braucht man aber nicht unbedingt. Im ökonomischen Kontext von „Industrie 4.0“ geht es um eine einschneidende Veränderung von Produktionsprozessen und Geschäftsmodellen – und damit um einen wesentlichen Faktor für Investitionsentscheidungen.
Die Vernetzung aller Prozesse von der Kundenbestellung über die Rohstofflieferung, die Steuerung aller Details der Produktion in allen Niederlassungen, die Lagerhaltung und die Auslieferung kann Abläufe effizienter machen und Kosten reduzieren. Probleme lassen sich frühzeitig erkennen und beheben. Welche Grundstoffe und Additive werden für welchen Produktionsauftrag wo gebraucht, welche Maschinen sind erforderlich, wie sieht die Auslastung aus? Produktionsunterbrechungen lassen sich vermeiden, wenn die Verschleißrate für jede Komponente bekannt und die Wartung optimal koordiniert ist. Ausschuss lässt sich minimieren, wenn Prozesse laufend analysiert und frühestmöglich neu justiert werden. Einzelne Chargen oder Produkte lassen sich exakt kennzeichnen und rückverfolgbar machen – bei Medizinprodukten oder Autobauteilen etwa ist das wichtig. Industrie 4.0 erhöht die Flexibilität: Produkte lassen sich kurzfristig auch in kleinen Stückzahlen nach Kundenwunsch in Form, Funktion, Zusammensetzung oder Farbe fertigen.
Manche Unternehmen der Kunststoffindustrie beginnen erst, sich mit den Chancen und Risiken dieses Wandels auseinanderzusetzen. Andere wie Igus sind da schon weiter. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, in „drei Jahren den automatisierten Prozess von der Online-Konfiguration bis hin zur digital unterstützten Fertigung für alle Produktkategorien in Betrieb zu nehmen“ – bis hin zum Service, so Gerhard Baus.Vorangetrieben wird der Wandel durch die raschen Fortschritte im Bereich 3D-Druck. Dabei werden Komponenten Schicht für Schicht additiv aus unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt. Kunststoffe eignen sich dafür besonders gut. Nach einer internationalen Studie von Ernst & Young haben mehr als ein Drittel der untersuchten Unternehmen aus der Kunststoffbranche bereits Erfahrungen mit 3D-Druck gemacht. Deutsche Firmen sollen bereits 1 Mrd. Euro im Jahr mit entsprechenden Produkten umsetzen.
Kunden machen sich unabhängig
Allerdings: Die Investitionskosten sind hoch, es ist viel Know-how erforderlich. Unternehmen, die die notwendigen Mittel haben, können Bauteile selbst nach Bedarf herstellen. Das ist keine Utopie mehr: BMW und Tochter Rolls-Royce tun es schon, die Lkw-Sparte von Daimler will die Produktion von Ersatzteilen zügig ausbauen. Auch die Deutsche Bahn ist auf diesen Zug aufgesprungen. Das Unternehmen hat sogar das Netzwerk „Mobility goes additive" initiiert, um mit Partnern wie Siemens Lösungen für die Mobilitäts- und Logistikbranche voranzutreiben.
Diese wachsende Unabhängigkeit bisheriger Kunden ist für manche Hersteller keine gute Nachricht. „Schon heute kann ich mir – nicht nur bei Kleinserien – Projekte vorstellen, die sich additiv besser lösen lassen als mit konventionellen Methoden. Das wird kommen und es wird Prozesse, die heute noch üblich sind, vollständig ablösen“, sagt Gerhard Baus von Igus. Karl-Heinz Bußbach von Azo bezeichnet den 3D-Druck als „disruptive Technologie“. Doch auch für diese Technologie werden Rohstoffzuführungen benötigt werden. Igus präsentiert auf der Messe neue, leistungsfähigere 3D-Druck-Materialien. Covestro entwickelt derzeit „ein umfangreiches Sortiment an Filamenten, Pulvern und Harzen für alle gängigen 3D-Druckverfahren“, so Dr. Ulrich Liman, Leiter Forschung & Entwicklung im Geschäftsbereich Polyurethane. Evonik arbeitet seit mehreren Jahren an speziellen Kunststoffmaterialien, die die industrielle Fertigung von Hightech-Bauteilen im 3D-Druck ermöglichen sollen. Der Konzern erweitert dafür die Kapazitäten: Eine neue Produktionsstraße soll Ende 2017 in Betrieb gehen. Zudem will sich Evonik Industries an dem „Open Platform Program“ von HP beteiligen und maßgeschneiderte Materialien für HPs Multi-Jet-Fusion-Technologie in den Markt bringen.
Für die Unternehmen geht es jetzt darum, die Geschäftsmodelle anzupassen. „Wenn sich der 3D-Druck so entwickelt, wie viele vorhersagen, wird das ganz sicher für Probleme in der Branche sorgen“, sagt etwa Gerhard Baus von Igus. Neue Chancen dagegen ergeben sich für jene Firmen, die den Wandel schnell genug mitvollziehen und etwa Materialien und Technik für den 3D-Druck anbieten.