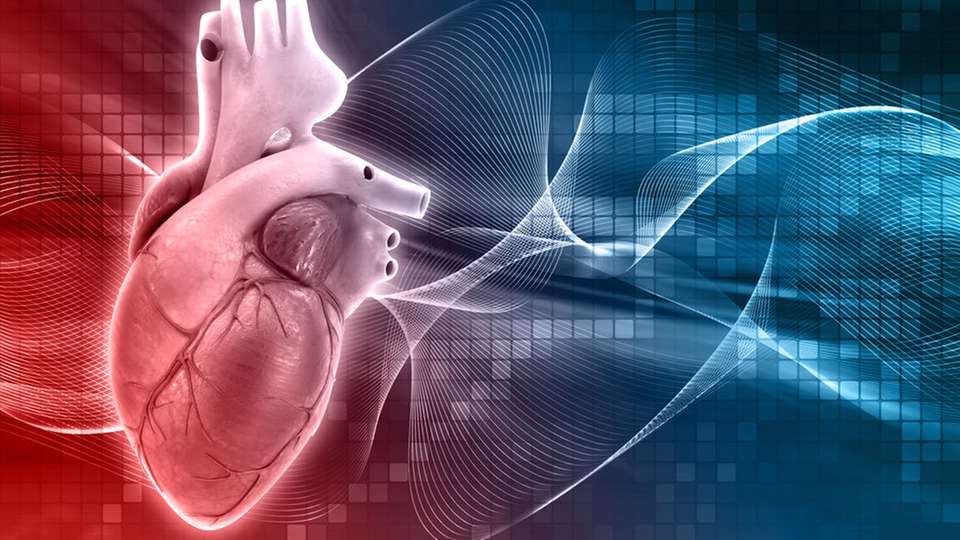Für viele Patienten sind künstliche Herzpumpen lebensnotwendig - sie können sich aber schnell auch als lebensgefährlich erweisen, wenn das Immunsystem das für ihn fremde Material abstößt.
Künstlich und doch körpereigen
Deshalb wollen Schweizer Wissenschaftler im Rahmen des Projekts Zurich Heart gängige Herzpumpen weiterentwickeln und Alternativlösungen finden. Am Ende soll ein voll implantiertes, künstliches Herz stehen. Rund 20 Forschungsgruppen in der Schweiz sowie am Deutschen Herzzentrum Berlin bündeln dazu ihre Kompetenzen.
Das Materialforschungsinstitut Empa fährt einen Tarnkappen-Satz: Die Wissenschaftler wollen eine künstliche Herzpumpe produzieren, deren innere Fläche mit patienteneigenen Zellen bedeckt ist. Damit wäre die Herzpumpe für das Immunsystem „unsichtbar“ und würde also nicht abgestoßen werden. Die Basis für diese Tarnschicht sollen besondere Textilien bilden.
Vlies trifft Körperzellen
Beim Kontakt mit künstlichen Herzpumpen bilden sich oft Blutgerinnsel, die Schlaganfälle oder Embolien verursachen können. Wenn aber die Wand der Herzpumpe eine Art Beschichtung erhält, die vom Blut als natürliche Umgebung wahrgenommen würde, könnte man in der Theorie Blutgerinnseln vorbeugen.
Blutgefäße sind auf der Innenseite mit einer Schicht Endothelzellen ausgekleidet. Sie regulieren den Austausch zwischen Blut und Körpergewebe. Deshalb arbeiten die Empa-Wissenschaftler nun an einem hauchdünnen Vlies aus aneinander haftenden Polymerfasern, die weniger als ein Mikrometer dünn sind.
Auf diesem Gewebe werden lebende Endothelzellen angesiedelt und bilden eine Schicht, wie es sie in allen Lymph- und Blutgefäßen gibt. Eine solche Gewebeoberfläche könnte dem Blut vorgaukeln, dass es sich bei der Pumpe um ein körpereigenes Organ handelt. Damit sich die Endothelzellen in dem künstlichen Gewebe rundum wohl fühlen, müssen sie sich an dem Vlies gut festhalten können. Ein einfaches Vlies aus Polymerfasern ist dafür kaum geeignet.
Elektrospinnen weben die richtige Beschichtung
Hier kommt die Elektrospinn-Anlage der Empa zum Einsatz. Damit lassen sich Polymere mit Durchmessern von unter einem Mikrometer herstellen - sowohl rein organische als auch Hybridfasern. Diese ermöglichen neuartige Membranen für den Einsatz in der Medizintechnik, in der Katalyse und in der Filtertechnik.
Zwischen einer Kanüle, aus der eine Polymerlösung gedrückt wird, und einer Gegenelektrode ist eine elektrische Spannung angelegt – und sie zieht Fäden. Dank des elektrischen Felds verwirbeln sich die Fäden, bis sie eine gewebeartige Membran bilden. Hält man sie in der Hand, fühlt sie sich an wie ein hauchdünner, elastischer Lappen.
„Die Membran für die Herzpumpe muss stabil und beständig sein und in alle Richtungen gedehnt werden können“, sagt Giuseppino Fortunato von der Abteilung Biomimetic Membranes and Textiles. Die Membran muss so einiges aushalten - schließlich schlägt das menschliche Herz bis zu 100.000 Mal am Tag.
Faser-Muskel-Hybriden Halt geben
Im Inkubator können auch Mischgewebe aus Fasern und Zellen entstehen. Um die Zellen kümmert sich dabei das Biointerface-Team von Katharina Maniura. Sie verwenden dazu glatte Muskelzellen, welche auf der hybriden Membran eine Zellstruktur bilden, wie sie auch in natürlichen Blutgefässen zu finden ist. Auf diesem Unterbau sollen dann Endothelzellen angesiedelt werden.
Besonders wohl fühlen sich die Zellen, wenn sie einen Unterbau vorfinden, der sie an körpereigene Strukturen erinnert - genauer gesagt an Kollagenfasern. etwa aus dem Bindegewebe. „Wir müssen Muskelzellen dazu bringen, Kollagen zu produzieren, dort haften die Endothelzellen dann dauerhaft“, erklärt Maniura. Sie führt weiter aus: „Wenn das Gewebe aus zwei Typen von Zellen besteht, senden sie Signale aus und tauschen sich so untereinander aus. Das hat ebenfalls den Effekt, dass die Endothelzellen auf der Oberfläche stabilisiert werden und bereitwillig ihre natürlichen Aufgaben übernehmen.“
Um die durch das Elektrospinnen hergestellten Fasern für die Zellen besonders attraktiv zu machen, sollen die Polymerfasern mit Zellhaftungspeptiden funktionalisiert werden. Sowohl den Endothel- als auch den Muskelfaserzellen soll die ihnen typische natürliche Umgebung präsentiert werden – damit das Gesamtkonstrukt möglichst lange lebt.
Realitätsabgleich im Bioreaktor
Ob das Ganze in der Praxis funktioniert, wird in einem Bioreaktor untersucht. Darin wird das Materialsystem von den Zurich-Heart-Teams entwickelte synthetische Elastomer-Pumpenwand zusammen mit dem Zell-Textilmaterial der Empa simulierten Realbedingungen ausgesetzt. Der Reaktor bildet die Situation im menschlichen Körper nach, lässt anstelle von Blut eine Zellkulturflüssigkeit vorbei pulsieren simuliert also Pulsschläge, die die Bewegungen des Herzmuskels imitieren. Dies soll den Forschern zeigen, ob die getarnten Materialien der hohen Belastung im menschlichen Körper standhalten.
Noch dieses Jahr wollen die Forscher eine Studie mit den ersten Prototypen der biomimetrischen Herzpumpen durchführen. Bis zu einer klinischen Anwendung werden aber noch einige Jahre vergehen.