Große und komplexe Bauteile aus verschiedenen Metallen innerhalb weniger Stunden herstellen – das ist mittlerweile Realität: In 3D-Druckern wird Metallpulver in dünnen Schichten aufgetragen, vom Laser verschmolzen und Schicht für Schicht entsteht das gewünschte Objekt. Doch bei manchen Materialien, wie zum Beispiel bei Permanentmagneten, stößt diese Methode an ihre Grenzen. Denn die Mikrostruktur der 3D-gedruckten Bauteile weicht häufig wesentlich von herkömmlich gefertigten Teilen ab. Der entscheidende Unterschied: die extrem schnellen Kühlraten. Nachdem der Laser den zu schmelzenden Bereich passiert hat, kühlt das Material in weniger als einer Sekunde um mehr als 1.000 °C ab. Dadurch haben die Elemente nicht genügend Zeit, sich so anzuordnen, dass maximale permanente magnetische Eigenschaften erreicht werden können.
Die Überprüfung der Elementverteilung kann bisher nur ex-situ, also erst nach dem Herstellungsprozess analysiert werden – auch bei nicht-magnetischen Bauteilen. „Das kostet enorm viel Zeit und Geld“, erklärt Dr. Anna Rosa Ziefuß, Gruppenleiterin Oberflächenchemie und Laserprozessierung von Prof. Dr. Stephan Barcikowski. „Denn defekte Teile werden so erst nach dem teils mehrtätigen Prozess erkannt. Zur effektiven Qualitätssicherung ist eine in-situ-Prüfung deshalb entscheidend – gerade, wenn es um Materialien für die Luftfahrt oder Medizin geht.“
Echtzeitüberwachung durch Emissionsspektrometrie
Die Idee der Forschenden deshalb: die genaue Materialkomposition der Bauteile in Echtzeit zu überwachen. Das soll über die sogenannte optische Emissionsspektrometrie (OES) gelingen. Sie ist im 3D-Drucker installiert und analysiert jede Pulverlage direkt – in einer kaum vorstellbar großen Auflösung: eine Pulverlage ist rund 42 µm dünn, was etwa dem Durchmesser eines sehr feinen menschlichen Haares entspricht. Die Daten werden dann zu einem digitalen Modell zusammengeführt und am Computer untersucht. „Es gab bereits Drucker, die die Temperatur während des Prozesses messen können oder unregelmäßige Schmelzen, Poren oder Risse aufzeichnen. Aber diese Erweiterung um die Faktoren Zusammensetzung und Verteilung ist weltweit einzigartig“, sagt Ziefuß. Die DFG hat das Großgerät zum wesentlichen Teil finanziert.
Nun haben die Forschenden zwei Jahre Zeit zu zeigen, dass ihre Idee funktioniert. Das schwierigste dabei: die Datenauswertung. „Man stelle sich einen Würfel vor, dessen Seiten einen Zentimeter lang sind. Wir hätten hier rund zwei Millionen Messstellen. Es ist sehr aufwendig, diese Datenmenge im Nachhinein zu komprimieren.“ Eingesetzt wird der Drucker aber jetzt schon: Wie im Teilprojekt eines Sonderforschungsbereichs, bei dem es um die Additive Fertigung von Permanentmagneten geht.




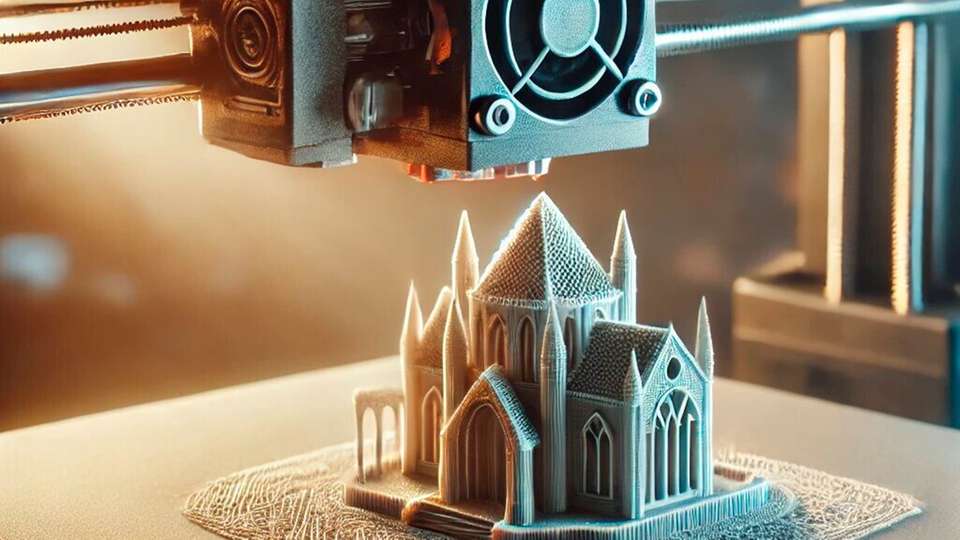

.jpg)







